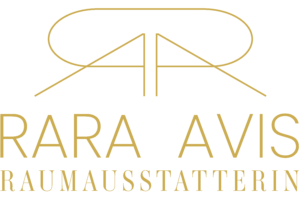Kleines Lexikon
Wir haben hier für Sie einige Fachausdrücke, Techniken und auch wichtige Personen rund um’s Poltern aufgelistet.
Derzeit befinden sich 123 Begriffe in diesem Verzeichnis
À blouse
Polstertechnik, die für das saubere Umpolstern komplizierter Stellen an Polstergestellen verwendet wird, wie z.B. bei Säulen von Armlehnbasen oder Rückenlehnen.
À chassis
Gepolsterter Einlegerahmen, der saisonal mit unterschiedlichen Bezügen ausgestattet wird. Diese Rahmen wurden in die Sitzgestelle eingelegt und waren ab dem 17. Jahrhundert populär.
À la Reine
Polstermöbel mit einer hohen, geraden Rückenlehne. Diese Stühle, auch als "siège meublant" bekannt, wurden in Salons an der Wand aufgereiht und nicht bewegt. Die Rückenlehnen wurden oft mit einfachen, kostengünstigen Stoffen bezogen. Bekannt seit dem 17. Jahrhundert.
Abheften
Technik, bei der Knöpfe durch die oberen Polsterschichten gezogen werden, um Vertiefungen zu erzeugen.
Abstemmen (Abschlagen)
Entfernen des alten Bezugs und der alten Polsterung von einem Möbelstück, bevor es neu gepolstert wird.
Ägyptomanie
Begeisterung für die Kunst und Kultur des alten Ägyptens, die im 17. Jahrhundert begann und während Napoleons Ägyptenfeldzug (1798-1799) ihren Höhepunkt erreichte (Empirezeit).
Art Nouveau (1890 - 1920)
In Frankreich übliche Bezeichnung für den Jugendstil, eine antihistorische Stilepoche, benannt nach dem 1895 in Paris eröffneten Geschäft "La Maison de l'Art Nouveau".
Arts-and-Crafts-Bewegung
Reformbewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts von William Morris in England ins Leben gerufen wurde. Ziel war die Bewahrung traditioneller Handwerkskunst und die Ablehnung industrieller Produktion sowie historisierender Formen.
Aufnähnadel
Rundnadel mit Bajonettspitze, die zum Anbringen von Federn auf der Gurtung und Federleinen verwendet wird.
Bergère
Niedriger Sessel mit größerer Sitztiefe, komplett gepolstert mit einem losen Kissen auf einer cuvette. Bekannt seit etwa 1735.
Bergère en confessional (Beichtstuhl)
Niedriger Sessel mit größerer Sitztiefe, komplett gepolstert mit einem losen Kissen auf einer cuvette. Bekannt seit etwa 1735.
Biedermeier (1810 - 1848)
Stilepoche im deutschsprachigen Raum, benannt nach dem fiktiven Autor "Gottlieb Biedermaier", der in satirischen Gedichten von Viktor von Scheffel erwähnt wird. Der Begriff wurde ab etwa 1900 als kunsthistorischer Stilbegriff verwendet.
Bourlet
Feste Kante, an der Spann- oder Fassonleinen fest um Faserstoff gerollt und angenagelt werden.
Bugholzmöbel
Möbel, die aus gedämpftem Buchenholz gefertigt werden. Michael Thonet revolutionierte den Möbelbau im 19. Jahrhundert mit seinen Bugholz-Sitzmöbeln.
Chaise longue
Verlängerter Sessel mit einem Kopfteil, auf dem die Füße hochgelegt werden können. Bei mehrfach geteilten Varianten spricht man von "Duchesse brisée".
Chauffeuse
Bequemer Stuhl aus der Belle Époque mit tiefem Sitzpolster und nach hinten ausgestellter Lehne.
Chippendale, Thomas (1709 - 1779)
Englischer Möbelzeichner und Kunsttischler, dessen Entwürfe großen Einfluss auf Sitzmöbel hatten. Bekannt für sachlich strenge Formen und durchbrochene Rückenlehnen.
Damenstühle
Niedrige Stühle mit weit ausschwingenden Armlehnen, um den gepolsterten Röcken ausreichend Raum zu lassen. Bekannt seit Mitte des 16. Jahrhunderts.
Danhauser, Josef
Berühmter Möbeltischler des Biedermeier, bekannt für moderne Möbelentwürfe in Österreich-Ungarn zwischen 1815 und 1830.
Doppelspitze (Matratzennadel)
Nadel mit Rund- oder Bajonettspitze an beiden Enden, zum Kantengarnieren, Durchnähen und Kopfheften.
Ebenist
Bezeichnung für Möbeltischler, die kostbares Ebenholz verarbeiten. Der Begriff wurde seit dem 17. Jahrhundert verwendet.
Eisengarn
Mehrfach gezwirnte Baumwollfäden, die durch Paraffinierung verstärkt werden. Diese Fäden werden in stabilen Geweben verwendet, insbesondere in den 20er und 30er Jahren.
Fassonleinen
Locker gewebter Leinenstoff, der zum Formen der Polsterung und für garnierte Kanten verwendet wird.
Fauteuil
Französischer Begriff für einen gepolsterten Sessel mit offenen Armlehnen, im Gegensatz zur Bergère.
Federn
Bestandteil der Polsterung, die für den Sitz und die Rückenlehne von Sessel und Sofa verwendet wird, um den Komfort zu erhöhen. Sie werden am Rahmen befestigt.
Fifties
Designstil der 1950er Jahre, geprägt von geschwungenen, stromlinienförmigen Formen, wie z.B. dem Nierentisch.
Formpolster
Im traditionellen Polsterhandwerk die wichtigste Polsterung, meist mit Naturfasern. Wird mit Lasierstichen angebracht und durchgenäht oder garniert.
Funktionssessel
Verstellbare Rückenlehne, später auch mit integrierten Fußschemel und veränderbaren Armlehnen. Bekannt seit der Renaissance.
Garnierte Kante
Feste, aufrechte Kante an den offenen Seiten der Polsterung; wird im ersten Polster mit Leiter- und Hinterstichen geformt und befestigt.
Geschnittene Nägel
Nägel mit kleinem Kopf, die sich leicht herausziehen lassen und die Fäden des Stoffes nicht teilen. Zum Anbringen von Molino-, Zuspann- oder Bezugsstoff.
Gondelstuhl
Komfortables Sitzmöbel, dessen Armlehnen von der hinteren Rückenlehne nach vorne hin abfallen und bündig in den Sitzrahmen münden.
Gründerzeit (1871 - 1900)
Benannt nach dem Industrialisierungsboom, der auf den Sieg über Frankreich und die Gründung des Deutschen Reiches 1871 folgte. Die Gründerzeit bediente sich vor allem historisierender Formen mit einer Tendenz zum Schweren.
Gurtung
Starke Gewebestreifen als Grundlage für Federn und Polsterung, die über das Gestell gespannt werden.
Haarzieher
Vielseitig verwendbares Werkzeug mit einer spitzen Seite und einem flachen Ende, z.B. zum Festhalten des Stoffs beim Nageln oder zum Verziehen der Füllung.
Josephinisch (1765 - 1790)
Österreichische Spielart des Louis XVI oder Zopfstils, benannt nach dem österreichischen Kaiser Josef II.
Jugendstil (1890 - 1920)
Bewegung, die nach der Zeitschrift 'Jugend' benannt ist und in München ab 1896 erschien. Sie gilt als Erneuerungsbewegung im Kunsthandwerk der Jahrhundertwende und steht für das Ideal des Gesamtkunstwerks.
Kanapee
Französisches Canapé, aus dem griechischen 'konopeion', ein alter Begriff für ein ägyptisches Ruhelager mit Moskitonetz.
Kapitonierung
Vertiefende Heftung, die in Europa Ende der 1830er Jahre aufkam und Flächen der Polstermöbelbezüge mit geometrischen Mustern verseh.
Klismos
Ein besonders standfester griechischer Stuhl aus dem 6. bis 5. Jahrhundert vor Christus, dessen Beine nach vorne und hinten ausgestellt sind.
Klumpsofa
Rundes oder halbrundes Kanapee mit Lehne in der Mitte, das von allen Seiten besessen werden kann.
Lasierstiche
Überlappende Fadenschlingen, die an Spann- und Fassonleinen angebracht werden, um die Füllung zu halten.
Louis XIV (1643-1715)
Der klassizistisch gefärbte Barockstil, inspiriert von Versailles, strahlte auf ganz Europa aus.
Louis XVI (1774-1793)
Stil, der ab 1760 stark klassizistisch geprägt ist. In Deutschland als Zopfstil, in Österreich als Josephinischer Stil bekannt.
Memphis
Postmoderne Designergruppe, die 1981 in Mailand gegründet wurde und für bunte, antifunktionalistische Kreationen bekannt ist.
Patina
Bezeichnet die natürliche Alterung der Holzoberfläche und ihrer Polituren, nicht jedoch Oberflächenverschmutzungen, Risse oder andere Beschädigungen.
Paumir
Bergère mit unterschiedlich hohen Armlehnen; die hohe Armlehne hat das Niveau der Rückenlehne.
Polsterfüllstoffe
Pflanzliche, tierische, chemische oder industriell hergestellte Füllstoffe, die zum Polstern verwendet werden.
Pompejanischer Stil
Von den Ausgrabungen in Pompeji beeinflusster Möbel- und Dekorationsstil des Empire.
Régence (1715 - 1723)
Französische Stilrichtung zur Zeit der Regentschaft zwischen Ludwig XIV und Ludwig XV.
Regency (1810 - 1830)
Stilbezeichnung für die englische Kunst, benannt nach der Regentschaft von Georg IV.
Settee
Englische Bezeichnung für eine Sitzbank mit Rückenlehne, die wie eine Aneinanderreihung von Stühlen aussieht, kann gepolstert oder ungepolstert sein.
Sheraton Thomas (1751 - 1806)
Englischer Kunsttischler und Möbelzeichner mit seinem ab 1791 in mehreren Auflagen erschienenen Möbelhandbuch "The Cabinet Maker and Upholsterer's Drawing Book" beeinflusste er die Möbelkunst der zweiten Hälfte des 18. Jhd und der ersten Hälfte des 19. Jhd in ganz Europa.
Siège volant
fliegende Möbel oder bewegliche Stühle, manchmal sogar mit Laufrollen ausgestattet. Bei Bedarf in die Räumlichkeiten gebracht.
Sièges à la Reine
Sitzmöbel mit schlichtem Stoff als Rückenspannteil versehen, in Reihen an den Wänden angelehnt.
Sofa
arabisch "suffa", eine im Orient belegte Erhöhung des Fußbodens, mit Kissen und Teppichen belegt.
Spannleinen
Lockeres Juttegewebe, das für den Polstergrund und zum Fixieren der Füllung verwendet wird.
Sprungfedern
spiralförmige Feder, tailliert, kegel- oder zylinderförmig, findet bei hochwertigen Polsterungen in Sitz-, Lehn- und Armpolsterung Verwendung. Anfänglich wurden sie mit der Hand aus Eisendraht hergestellt. Heute werden sie in verschiedenen Stäken und Gangzahlen (Windungen) aus verkupfertem Stahldraht produziert.
Stilmöbel
Möbel, die einen vergangenen Stil imitieren oder sich an ihn anlehnen. Der Begriff im engeren Sinn wird für die Möbeln des Historismus in der zweiten Hälfte des 19. Jhd. gebraucht.
Vernis Martin
Effektvolle Lacktechnik, für welche die Familie Martin 1730 ein Patent erhalten hatte. Am bekanntesten war das grüne Vernis.
Verzierungen
Die Sichtbaren Nähte, Stoffabschlüsse und Kanten werden verdeckt du verziert. Dafür verwendet man Posamenten (z.B. Kordel, Fransen, Effilé, Marabu), Keder, Schabracken, Rosetten oder Ziernägel
Voyeuse
frz. Für Salonmöbel, Stuhl auf dem man sich auch rücklings setzen konnte. Die Rückenlehne hat die Form einer Violine und eine gepolsterte Armablage. Die Damen konnten knieend, wie auf einem Betstuhl den spielenden zusehen. Das Polster war dazu sehr tief angelegt.
Wachsgarn
gewachster Leinenfaden für Handnähte, die an Bezugsstoff und Besatz ausgeführt werden sollen.
Zuspannstoff
Ein leicht dehnbarer, fein gewebter Stoff zum Zuspannen der Unterseite eines Möbelstücks; der den Staub fängt und die Kanten sauber abschließt.